Vortrag im Rahmen der Oldenburger Ringvorlesung Philosophie „Krise als Chance?“ von Wolfgang Martin Stroh . Publiziert in Diskussion Musikpädagogik 50/2011.
Die Krise der Kreativwirtschaft als Chance der Kreativen
Voraussetzungen
Durch die technische Möglichkeit, Musik so gut wie „eins zu eins“ digital zu kopieren, ist in den vergangenen 25 Jahren eine Art Schattenwirtschaft des Musikhandelns entstanden. Zunächst wurden lediglich gekaufte CD’s für Freunde oder den Weiterverkauf auf Flohmärkten kopiert. Viele wertvolle Musiknummer beispielsweise aus der Zeit des Balkankrieges, von den politischen Bewegungen in Uruguay oder aus dem Inneren der Türkei habe ich auf diese Weise erworben. Ich habe sie besten Gewissen als Material für wissenschaftliche Forschung und für die Verbesserung meiner Hochschullehre verwendet und nie daran gedacht, einen Händler auf dem Bremer Flohmarkt anzuzeigen. Die auf solchen illegal kopierten CD’s gespeicherten Computerdaten waren so groß, dass auch bei schnellen Internetverbindungen kein „Online-Kopieren“ in Frage kam: 60 Minuten Musik in CD-Qualität sind immerhin 600 MB groß (eine CD kann 720 MB speichern).
Diese Art des Hardware-Kopierens jedoch war nichts Neues. Ganz Afrika, halb Lateinamerika und Asien hingen 30 Jahre mittels MC-Kopien am Tropf der Multikonzerne der Musikindustrie. Diese Schattenwirtschaft wurde von den Musikkonzerne aus strategischen Gründen toleriert, war doch die illegal kopierte MC die Einstiegsdroge in das „eigentliche“ globale Musikgeschäft. Irgendwie musste ein Bedürfnis nach global und industriell hergestellter Musik ja erst einmal erweckt werden. Die weltweit illegale Kopier-Schattenwirtschaft wurde also als eine Art Werbung „abgerechnet“. (Ich hebe diesen Gedanken hervor, weil er heute das Pro & Contra um kostenloses Downloaden bestimmt.)
Im Laufe der 1990er Jahre wurden Musikdateien mittels mp3 kleiner gemacht, wobei der hörbare Qualitätsunterschied sich in Grenzen hält und offensichtlich akzeptiert wurde. An die Stelle der bisherigen Hardware-Kopie trat das schlichte Überspielen und Speichern von Computerdateien von Festplatte zu Festplatte. Und im letzten Jahrzehnt wurden die Übertragungsgeschwindigkeiten des Internet so weit gesteigert, dass die Übertragungszeit von Musikdateien via Internet kleiner ist als die Zeit, die das Abhören der Musik benötigt. Heute können über DSL die Daten eines 60-Minuten Musikstücks in wenigen Minuten übertragen werden.
Neben den weltweiten Kopiermarkt trat nun das Downloaden von Musik(dateien). Und das verlief global, schnell und so gut wie „immateriell“. Der Flohmarkthändler und der türkische Gemüseladen mit CD-Regal im Hintergrund verschwanden von der Oberfläche. Die Musikindustrie, die sich auf Hardware-Produkte spezialisiert hatte, war alarmiert und begann zusammen mit der GEMA, den Musikräten und Gesetzgebern um ihre gewohnte Gewinnmaximierung zu bangen.
Entwarnung vorweg! Nach einer Pressemitteilung des deutschen Bundesverbandes der Musikindustrie e.V. vom 25. 3.2010 stieg der Absatz von CD’s in Deutschland von 2008 auf 2009 um 1,5% auf 147,3 Millionen Euro. „CD’s, DVD’s und LP’s machen hierzulande immer noch 90 Prozent des Umsatzes mit Musik aus“, sagte der Geschäftsführer. (Der Umsatz von legalen Downloads erhöhte sich übrigens um 34,6% auf 118,3 Millionen Euro.) Und der Umsatz an traditionellen Tonträgern insgesamt hat sich „asymptotisch der Grenze von 1,5 Milliarden genähert und für 2011 wird ein Turnaround erwartet“ .
Da es aber heute dennoch ausgemacht zu sein scheint, dass (1) die Musikindustrie in einer schweren Krise sei und (2) die Ursache das massenweise illegale Downloaden von Musik ist, werde ich einige Richtigstellungen vornehmen. Denn selbst v.e.r.d.i. schreibt anlässlich einer Fachtagung am 26.4.2010 im Internet: „Nach einer kürzlich vorgelegten Untersuchung (TERA-Studie vom März 2010) hat die illegale Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte im Internet allein in Deutschland im Jahr 2008 bei Produktion und Vertrieb von Spielfilmen, TV-Serien, Musik und Software einen Schaden von 1,2 Milliarden Euro verursacht und damit rund 34.000 Arbeitsplätze gekostet.“
Sehen wir uns diese populäre Argumentation genauer an:
Es ist irrig anzunehmen, jeder kostenlose Musikdownload hätte sich, wenn er nicht getätigt worden wäre, in einen Kauf umgesetzt. Das Kaufvolumen bemisst sich nach dem Taschengeld eines Jugendlichen. Wenn der kostenlose Download ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro hat, so ist dies also keineswegs die „Schadenshöhe“ der Musikindustrie.
Dass ein (fälschlicherweise unterstellter) Umsatzrückgang automatisch Arbeitsplätze kostet wie v.e.r.d.i . vorrechnet, ist die Bankrotterklärung einer Gewerkschaft aber kein stichhaltiges Argument. Es ist eine Assoziation aus der Kiste der Merkel-Phraseologie.
Dass die Gewinne und der Umsatz der Musikindustrie sich von den traditionellen Hardware-Tonträgern auf neue Segmente wie Klingeltöne, i-pod-taugliche Musikdateien und generell das legale Downloaden verschoben haben, wird meist nicht erwähnt. Allerdings fällt die erhoffte Gewinnmaximierung durch die Erschließung neuer Segmente geringer als erhofft aus. Denn die Tonträgerindustrie hat durch Zögern viel an Terrain gegenüber anderen Industriezweigen verloren . Mittels GEMA etc. versucht sie verzweifelt verlorenes Terrain zurück zu gewinnen. Der GEMA-Umsatz ist 2009 um 2 % gestiegen .
Dass der Umsatz traditioneller Tonträger im verflossenen Jahrzehnt gegenüber den 1990er Jahren zurück gegangen ist, kann mehr als nur die genannten Ursachen haben. Erstens stieg der Umsatz aufgrund der Umstellung von LP auf CD in den 1990er unmäßig an und ging dann wieder auf Normalniveau zurück. Zweitens stagniert die Popmusik-Produktion inhaltlich seit 15 Jahren, es gibt keine neuen Stile und Trends, so dass es wenig Anreiz zu Neukäufen gibt. Eine Folge ist der Versuch der Musikindustrie, Revival-Wellen zu inszenieren, die erheblich weniger Produktionskosten verursachen. Dass sich die Musikindustrie innovativen Musikstilen wie beispielsweise der türkisch-arabischen Popmusik noch vollkommen verschließt, ist trotz des 11. Septembers pure Ignoranz und Dummheit.
Das Internet hat neben der herkömmlichen Fremdvermarktung via Plattenvertrag die Möglichkeit der Selbstvermarktung von Musiker/innen geschaffen. Hierzu gibt es Beraterfirmen, spezifisch Programmierer, Internetplattformen und –betreiber, Techniken (wie z. B. alle mit einem „i“ versehenen Geräte). Dieser Sektor stellt die eigentliche Konkurrenz der Musikindustrie dar, doch da er unangreifbar ist, wird er ignoriert und schamhaft nicht thematisiert.
Dass das kostenlose Downloaden von Musikdateien, die übrigens um den Faktor 10 kleiner als Dateien von CD-Qualität, also nicht einmal absolut „ein zu eins“ sind, den Umsatz traditioneller Produkte der Musikindustrie kausal minimiert, ist nicht bewiesen. Die von vielen Musiker/innen, die industriell vermarktet werden – Madonna, Prince usw. - , vertretene Meinung ist, dass der kostenlose Download zum CD-Kauf anregt, und letzterer lediglich durch das Taschengeld der Käufer/innen begrenzt ist. Das Argument ist vergleichbar demjenigen, dass Konzerte nicht vom CD-Kauf abhalten sondern zum Kauf animieren.
Insgesamt ist die Musikindustrie extrem konservativ: sie verschläft Innovationen musikalischer und technischer Art, bejammert den Niedergang veralteter Produktionsweisen und produziert anlässlich ihres Erwachens nun massiv Ideologie, weil eine Reihe innovativer Märkte von anderen Industriezweigen übernommen worden sind. Arbeitsplatzmäßig hat sich, wenn überhaupt, eine jener vielen Umverteilungen – übrigens weitgehend innerhalb des Einzugsgebiets von v.e.r.d.i. abgespielt, von denen die globale Wirtschaft lebt.
Dennoch lässt es der verängstigten Musikindustrie seit 2004 keine Ruhe, dass sie die technischen Entwicklungen des Internetzeitalters weitgehend verschlafen und Marktsegmente an andere Industriezweige abgegeben hat.
Für mein heutiges Thema von Interesse ist der strategische Schwenk der Argumentation der deutschen Musikindustrie beim Kampf um den Erhalt der gewohnten Gewinnmaximierung. Ich werde diesen Schwenk aus musikpädagogischer Perspektive betrachten, weil die deutsche Musikindustrie in zwei Kampagnen 2004 und 2009 die Musikpädagogik um Hilfe gerufen hat. Der Grund liegt darin, dass die deutsche Musikindustrie Kinder und Jugendliche nicht nur als potente Käufer/innen ihrer Produkte, sondern auch ihre potentiellen Feinde ausgemacht hat, sind es doch gerade Kinder und Jugendliche mit wenig Taschengeld, die sich Musik kostenlos aus dem Internet downloaden statt diese käuflich zu erwerben.
Ich kann hier gleich verraten, dass der Schwenk der Strategie der deutschen Musikindustrie etwas „Philosophisches“ an sich hat und daher mich auch legitimiert, hier und heute vor Ihnen zu sprechen.
Die Einführung der Ethik in die Strategie der Musikindustrie
Die alte Strategie
Die traditionelle und heute auch noch vorherrschende Strategie der Musikindustrie den Rückgang der gewohnten Gewinnmaximierung zu stoppen ist die juristische Verfolgung der Straftat „Kopieren von geschützter Musik“. Lassen Sie mich kurz schildern, wie in einem vom Schottverlag herausgegebenen Sonderheft der Zeitschrift „Musik & Bildung“ mehrere Unterrichtseinheiten vorgestellt wurden, mit denen den Schüler/innen ein Unrechtsbewusstsein über illegales Kopieren geschützter Musik beigebracht werden sollte.
Thema des Unterrichts ist der Song „Alles nur geklaut“ der Stuttgarter Gruppe „Die Prinzen“ aus dem Jahr 1993 sein. Bei MyVideo und Youtube gibt es viele Videoclips zu diesem Titel. Ich habe ein paar Clips zusammen geschnitten und mich jeweils auf den nach „Musik & Bildung“ pädagogisch wertvoller Schlussrefrain beschränkt:
Zwei Karaoke-Versionen von Jugendlichen, eine Art Cover-Version von Sha (mit Parodie-Text), ein Mitschnitt eines Live-Konzerts, eine Bananen-DDR-Interpretation, zwei „Politcollagen“, eine davon „Rammstein-artig“ .
Video 1 Alles nur geklaut
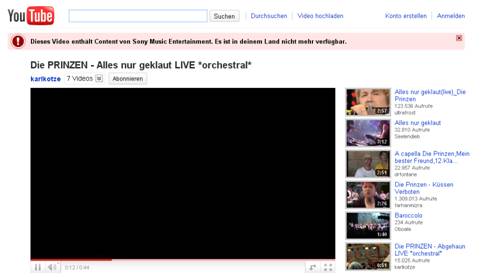 Die Videoclips zeigen, wie kreativ Jugendliche mit Musik umgehen können. Sie stellen öffentlich dar, wie sich Jugendliche Musik „aneignen“. Natürlich spielt dabei auch eine Rolle, dass diese Aneignung nicht nur kreativ sondern auch illegal ist, denn schließlich wird fast überall der originale CD-Sound unterlegt und somit zum kostenlosen Download feilgeboten. Der musikpsychologische Begriff der „aktiven kreativen Aneignung“ erhält hier seinen prickelnden Reiz durch genau das, was die deutsche Musikindustrie „Diebstahl“ nennt. Denn die Aneignung ist zugleich auch Veröffentlichung – ganz dem Postulat der dialektischen Tätigkeitstheorie folgend, dass Aneignen nicht nur individuelle Bereicherung der Innen- sondern auch Veränderung der Außenwelt ist.
Die Videoclips zeigen, wie kreativ Jugendliche mit Musik umgehen können. Sie stellen öffentlich dar, wie sich Jugendliche Musik „aneignen“. Natürlich spielt dabei auch eine Rolle, dass diese Aneignung nicht nur kreativ sondern auch illegal ist, denn schließlich wird fast überall der originale CD-Sound unterlegt und somit zum kostenlosen Download feilgeboten. Der musikpsychologische Begriff der „aktiven kreativen Aneignung“ erhält hier seinen prickelnden Reiz durch genau das, was die deutsche Musikindustrie „Diebstahl“ nennt. Denn die Aneignung ist zugleich auch Veröffentlichung – ganz dem Postulat der dialektischen Tätigkeitstheorie folgend, dass Aneignen nicht nur individuelle Bereicherung der Innen- sondern auch Veränderung der Außenwelt ist.
Nur selten schreitet „Sony Entertainment“ bei der Freigabe des CD-Sounds ein, das erscheint aber eher zufällig (Abbildung: gesperrtes Youtube-Video).
Was im Internet geschieht, steht in krassem Kontrast zu dem, was in der Unterrichtseinheit von „Musik & Bildung“ vorgeschlagen wird. Hier soll zwar auch das Stück nachgespielt werden. Dazu wird gesagt: „Am besten prägt man sich die Melodie durch das Mitsingen mit der [legal gekauften] Originalaufnahme ein“. Noten hat ein „Prinzen“-Mitglied beigesteuert und über allem steht auch geschrieben „T & M: Tobias Künzel“. Die Copyright-Fragen sind geklärt und bei der GEMA abgerechnet. Das Nachspielen des Titels durch die Schüler/innen soll nicht, wie auf den Youtube-Videos, zur Präsentation in einer Öffentlichkeit stattfinden, sondern einem lehrhaften Zweck dienen. Nachdem alles gemeinsame Musizieren Spaß gemacht hat, kommt der pädagogische Wehrmutstropfen: „Fazit: Fast jeder hat sich schon mal zu Unrecht bereichert. Und niemand hat das erlaubt. Wer klaut, lebt also immer mit der Angst erwischt zu werden und hat ständig ein schlechtes Gewissen. Vielleicht haben deshalb die Prinzen dieses Stück nicht geklaut, sondern selbst geschrieben.“
 Dass eine derartige Unterrichtseinheit nicht nur zynisch ist, sondern auch den gewünschten Effekt nicht haben kann,
dürfte jedem musikpädagogisch einigermaßen Erfahrenen klar sein. Die Schüler/innen werden sich
durch ein „Fazit“ wie das zitierte überwiegend provoziert und diffamiert fühlen: Wo soll hier denn
Unrecht geschehen sein? Was habe ich den Prinzen denn weggenommen? Wie habe ich mich durch den Download bereichert? Ich habe doch gar kein schlechtes Gewissen!
Dass eine derartige Unterrichtseinheit nicht nur zynisch ist, sondern auch den gewünschten Effekt nicht haben kann,
dürfte jedem musikpädagogisch einigermaßen Erfahrenen klar sein. Die Schüler/innen werden sich
durch ein „Fazit“ wie das zitierte überwiegend provoziert und diffamiert fühlen: Wo soll hier denn
Unrecht geschehen sein? Was habe ich den Prinzen denn weggenommen? Wie habe ich mich durch den Download bereichert? Ich habe doch gar kein schlechtes Gewissen!
(Abbildung: Freude über legales Betrachten von Musikdateien gemäß § 52a Urheberrechtsgesetz aus dem Jahr 2003.)
Die neue Strategie
Im Mai 2009 wurde den Mitgliedern des „Arbeitskreises für Schulmusik“ in ihrem Verbandsmagazin mitgeteilt, dass sich der Vorsitzende des Verbandes im Beirat eines Projektes befindet, das an der Musikhochschule Hannover angesiedelt ist, den Titel „PlayFair – Respect Music“ trägt und das Ziel hat
 „Kreativen Musikunterricht an Schulen zu aktivieren bzw. animieren, kulturelles Bewusstsein für Musik zu wecken, der
Entwertung von Musik entgegenzuwirken und Illegale Downloads & Kopien zu bekämpfen“... „ Langfristig soll die
Wertschätzung von musikalisch-kreativen Leistungen einen breiten gesellschaftlichen Konsens finden.“
„Kreativen Musikunterricht an Schulen zu aktivieren bzw. animieren, kulturelles Bewusstsein für Musik zu wecken, der
Entwertung von Musik entgegenzuwirken und Illegale Downloads & Kopien zu bekämpfen“... „ Langfristig soll die
Wertschätzung von musikalisch-kreativen Leistungen einen breiten gesellschaftlichen Konsens finden.“
Das Forschungsprojekt wurde initiiert von Dieter Gorny, dem Gründer von VIVA und heutigen Vorsitzenden des Bundesverbandes Musikindustrie e.V.. Wissenschaftlich federführend ist Hans Bäßler (Abbildung), der Leiter der Schulmusikabteilung in Hannover und Vorsitzende des zweiten großen deutschen Musiklehrerverbandes „Verband Deutscher Schulmusiker. (vds)“ ist. Die konkrete Durchführung des Projekts hat Daniel Reinke, der Mitarbeiter beim Bundesverband Musikindustrie e.V. ist.
Das hier zitierte Forschungsprojekt – dessen Drittmittelgeber unschwer zu erraten ist – ist nur die skurrile Spitze eines Eisbergs, der sich in den letzten Jahren argumentativ aufgetürmt hat.
Dieter Gorny (Abbildung) hat nämlich vor einigen Jahren richtig erkannt, dass mit technischen Tricks das „ein zu eins“-Kopieren von Musikdateien nicht zu verhindern sei. Die diversen Methoden des Kopierschutzes erwiesen sich stets als Bumerang, denn einerseits kann man sie grundsätzlich technisch ebenso umgehen wie einführen – dies ist nur eine Frage des Know Hows von Programmierern -, andererseits haben die „ehrlichen“ Kunden häufig Schaden von kopiergeschützten Tonträgern, da diese nicht auf allen Abspielgeräten fehlerfrei laufen und es daher zu unangenehmen Regressansprüchen kommt.
 Dieter Gorny hat ebenso richtig erkannt, dass mit juristischen Mitteln der erwähnten illegalen Schattenwirtschaft nicht beizukommen ist. Dieser Wirtschaftszweig ist im wörtlichen Sinne ebenso verzweigt wie das Inter-Netz, die anfallenden Datenmengen und Rechtsbrüche sind so horrend umfangreich und zugleich diffus, dass einige wenige exemplarisch herausgegriffene Gerichtsurteile den Ruch der „Sippenhaft“ haben und nicht abschreckend, sondern solidarisierend wirken. Nach dem Motto: „Je mehr illegal gehandelt wird, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich herausgegriffen und bestraft werde“.
Dieter Gorny hat ebenso richtig erkannt, dass mit juristischen Mitteln der erwähnten illegalen Schattenwirtschaft nicht beizukommen ist. Dieser Wirtschaftszweig ist im wörtlichen Sinne ebenso verzweigt wie das Inter-Netz, die anfallenden Datenmengen und Rechtsbrüche sind so horrend umfangreich und zugleich diffus, dass einige wenige exemplarisch herausgegriffene Gerichtsurteile den Ruch der „Sippenhaft“ haben und nicht abschreckend, sondern solidarisierend wirken. Nach dem Motto: „Je mehr illegal gehandelt wird, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich herausgegriffen und bestraft werde“.
Dieter Gorny hat sich Gedanken gemacht, woran es liegt, dass die traditionelle juristische Methode, auf die die Bundesregierung, die GEMA und die Deutsche Musikwirtschaft sowie die internationale Musikindustrie setzt, erfolglos ist. Die herkömmliche These, dass jede juristische Regulierung eines Problems ein juristisches Unrechtsbewusstsein bei denjenigen voraussetzt, die reguliert werden sollen, hat er verworfen. Vielleicht sogar aufgrund von Erfahrungen mit misslungenen Erziehungsversuchen, wie sie das erörterte Unterrichtsbeispiel „Alles nur geklaut“ gezeigt hat. Dass die Androhung von Strafverfolgung nichts bringt, war ohnedies klar.
 Er hat daher gefordert, dass in Kindern und Jugendlichen ein ethisches und kein juristisches Unrechtsbewusstsein erzeugt werden soll und muss. Er forderte, kurz gesagt, die Implementierung eines ethischen Lernzieles in den Zielkatalog des Musikunterrichts an allgemein bildenden Schulen. Die Schüler/innen sollten eine solche Achtung vor der Musik bekommen, dass sie jedwede Art von Betrug moralisch verabscheuten und freudig erregt ihr Taschengeld für einen kostenpflichtigen Download opferten, auch wenn es unter einer anderen Adresse des Netzes einen kostenlosen Download gegeben hätte. Schlüsselbegriff dieser zu unterrichtenden Ethik wurde „Kreativität“ (Abbildung: Sonderheft von „Musik & Bildung“ 2004.).
Er hat daher gefordert, dass in Kindern und Jugendlichen ein ethisches und kein juristisches Unrechtsbewusstsein erzeugt werden soll und muss. Er forderte, kurz gesagt, die Implementierung eines ethischen Lernzieles in den Zielkatalog des Musikunterrichts an allgemein bildenden Schulen. Die Schüler/innen sollten eine solche Achtung vor der Musik bekommen, dass sie jedwede Art von Betrug moralisch verabscheuten und freudig erregt ihr Taschengeld für einen kostenpflichtigen Download opferten, auch wenn es unter einer anderen Adresse des Netzes einen kostenlosen Download gegeben hätte. Schlüsselbegriff dieser zu unterrichtenden Ethik wurde „Kreativität“ (Abbildung: Sonderheft von „Musik & Bildung“ 2004.).
Und damit hatte Peter Gorny nun die Vorstände der beiden großen deutschen Musiklehrerverbände überlistet! Kreativität ist das, was alle gerne haben: Musikunterricht soll kreativ sein, soll kreativ machen und setzt Kreativität auf seiten der Lehrer/innen, der Musiker/innen, der Lehrpläne, Schulbücher, Songtexte, Midifiles, Klassenarrangements, WarmUps, Keyboardsounds usw. voraus. Das Schlagwort heiligt die Mittel. Denn, was die Musikindustrie unter Kreativität versteht, wie sie diese erzeugt und vermarktet, wozu sie diese benötigt und warum das Knacken eines Kopierschutzes, das Tauschen von Musikdateien in sozialen Netzwerken, die Zusammenstellung einer Geburtstags-CD für einen Freund , ein Videoclip in Youtube mit Original-Soundtrack nicht „kreativ“ sein sollen... das alles wird nicht mehr gefragt.
Ich möchte aber solche Fragen stellen!
Fragen an die Kreativwirtschaft
1. Warum kann sich die von Adorno und Horkheimer beschimpfte „Kulturindustrie“ heute stolz „Kreativwirtschaft“ nennen? Was ist da im gesellschaftlichen Bewusstsein geschehen? 2. Warum leuchtet es offensichtlich Kindern und Jugendlichen nicht spontan ein, dass die Gewinne der Musikindustrie mit einer Zunahme an kreativer Musik, an denen sie interessiert sein müssten, korrelieren? 3. Warum soll der jugendliche Wunsch selbst kreativ zu sein und zu werden durch den Erwerb vorbildlicher Produkte der Kreativwirtschaft erfüllt werden? Wer oder was würde wirklich Schaden erleiden, wenn die Kreativwirtschaft ab sofort nur noch halb so viel produzieren würde? 4. Warum soll ein industrielles Lied, nur weil es technisch perfekt zu sein scheint, kreativer sein als ein selbstgemachtes Lied, das es niemals zu einem Plattenvertrag bringen wird, das aber mit großem Spaßfaktor vor Freunden aufgeführt und einer virtuellen Fangemeinde vorgeführt werden kann? 5. Warum soll die industrielle und multinationale Fremdvermarktung von Musik mehr dem Schutz von Kreativität dienen als das verzweigte System der Selbstvermarktung von Musik im Internet? |
1. Warum kann sich die von Adorno und Horkheimer beschimpfte „Kulturindustrie“ heute stolz „Kreativwirtschaft“ nennen? Was ist da im gesellschaftlichen Bewusstsein geschehen?
<
Der Begriff „Kulturindustrie“ ist als Terminus der Kritischen Theorie entstanden. Es sollte eine Horrorvorstellung sein, dass Kultur industriell und nach den Gesetzen des Kapitalismus produziert wird. Implizit sagte Adorno, dass die industriell produzierte Kultur keine „wahre“ Kultur ist.
Nach meiner Erinnerung sprach man bis in die 1970er Jahre hinein in musikwissenschaftlichen Kreisen von der Schallplattenindustrie und noch nicht von der Musikindustrie. Diese Terminologie war insofern differenziert, als sie zwischen dem kommerziellen Produkt Schallplatte und der Musik unterschied. Musik war nach wie vor gedacht als eine Dienstleistung, die Musiker für Andere erbringen. Der Konsum einer solchen Dienstleistung ist mit dem Verzehr eines Butterbrotes vergleichbar: ist das Butterrot verzehrt, ist es weg, ist die Dienstleistung erbracht, ist sie weg. Das Ergebnis des Konsums ist einmal, dass der Konsument satt ist, das andere mal, dass er erbaut oder emotional gerührt ist. Wenn Musik aber auf eine Schallplatte gegossen wird, so wird aus der Dienstleistung eine Ware mit ganz ungewöhnlichen Eigenschaften:
(1) Eine Dienstleistung im herkömmlichen Sinn wird nun nur noch einmalig im Studio erbracht.
(2) Der Kauf der Schallplatte berechtigt und ermöglicht dem Käufer beliebig viele Konsumakte.
(3) Weil zudem beliebig viele Menschen solche beliebig vielen Konsumakte vollziehen können, wächst der Wert der ursprünglichen Dienstleistung im Studio ins potentiell Unermessliche.
Im Gegensatz zum materiellen Eigentum, beispielsweise einem Butterbrot, ist die Musik einer Schallplatte nach dem Kauf und nach dem Konsum (= Anhören) nicht verschwunden. Musik als Ware kann man nicht so verzehren wie Musik als Dienstleistung. Und genau an diesem Umstand verdient sich die Musikindustrie ihre goldene Nase.
Es gibt zwei Modelle, nach denen die Musikindustrie die Dienstleistung eines Musikers, die die Schallplatten-Warenproduktion voraussetzt, bezahlt wird. Das feudalistische und imperialistische Modell ist, dass die Musiker wie Dienstleister für ihre Arbeitszeit entlohnt werden, als ob sie vor einem Publikum spielten. Die Höhe des Lohnes ist Verhandlungssache. Dies Modell wird heute bei Anfängern, bei musizierenden „Nebenrollen“ im Produktionsprozess und vor allem bei Musikern aus Entwicklungsländern angewandt. Ein bekanntes Beispiel waren die Musiker, die den Film „Bien Vista Soviel Club“ einspielten. Sie erhielten ein für Kuba monströses Honorar und waren solange überglücklich bis sie bemerkten, dass ihr Produzent den Film und die CD in immer neuen Auflagen rund um die Welt verkauft und dabei pausenlos seinen prozentualen Anteil eingestrichen hat, während sie lediglich die Ehre hatten „berühmt“ zu sein.
Das zweite, das kapitalistische Teilhaber-Modell besteht hingegen darin, dass die Musiker einen gewissen Anteil am Gewinn oder Umsatz ausbezahlt bekommen und damit am Gesamtgeschäft mitbeteiligt sind. Der Anteil beträgt in der Regel 2 bis 5 %. Dies Modell wird meist nur auf einige Hauptakteure angewandt, die meisten Beteiligten (Studiomusiker, Techniker etc.) werden einmalig honoriert.
Die Dividende der Aktionäre der Musikindustrie wird umso höher, je weniger Menschen prozentual am Gewinn beteiligt, je niedriger die Honorare und je größer der Umsatz ist. Die meisten Produktionskosten fallen nur einmal an. Anschließend liegen die Einzelkosten pro Scheibe bei 50 Cent.
Das Wort „Schallplattenindustrie“ enthielt noch die Differenz von Musik als Dienstleistung und Musik als Ware. Die Abrechnungsmodalitäten der Musikindustrie tun dies ebenso. Aber das heute gebräuchliche Wort „Musikindustrie“ hebt diese Differenz im Denken auf. Nun scheint auch die Musik und nicht nur die Schallplatte eine industriell produzierte Ware zu sein. – Genau dies hatten Horkheimer und Adorno als Horrorvision vorhergesehen.
Des Horrors nicht genug!. Seit etwa 4 Jahren gibt es nun das Wort „Creative Industries“ oder zu Deutsch „Kreativwirtschaft“. Damit ist – zunächst nur im Denken, nicht in der Realität! – eine menschliche Eigenschaft und Fähigkeit, die sich in Musik äußern kann, scheinbar auch zur Ware geworden, die produziert, verkauft und konsumiert werden kann. Es ist aber jedermann klar, dass der Konsum solcherart industriell hergestellter Kreativität dasselbe Ergebnis haben wird wie der Konsum von Musik: Erbauung, Rührung, Bildung, Entspannung, Trost, Animation... Mit anderen Worten, Kreativität kann man gar nicht konsumieren.
Dies behauptet die Musikindustrie, die sich heute „Kreativwirtschaft“ nennt, auch gar nicht. Sie behauptet eigentlich nur, dass sie eine menschliche Eigenschaft, die gesamtgesellschaftlich als positiv angesehen wird, reproduziert und damit am Leben erhält. Musik kodiert auf einem Tonträger oder in einer Computerdatei ist nach wie vor bezogen auf Verwendungszweck und Konsumgewohnheiten „gut“ oder „schlecht“, „brauchbar“ oder „unbrauchbar“.
Der Terminus „Kreativwirtschaft“ erschien mir selbst, als ich ihn zum ersten Mal aus dem Munde von Dieter Gorny hörte, als ein typischer Blubber-Begriff. Doch dann las ich, dass es bei der „Kreativität“ der „Kreativwirtschaft“ gar nicht um eine Eigenschaft ihrer Produkte, sondern um den Standort Europa im Kampf gegen das chinesische Milliardenheer geht:
Hier eine Definition: Die ‚Creative Industries‘ erzeugen und vermitteln kreative Inhalte. Ihr Produkt ist eine schützenswerte Leistung. Durch die Erzeugung und Auswertung dieses geistigen Eigentums schaffen sie Wertsteigerung und Arbeitsplätze. Diese Wertsteigerung geht nicht von einzelnen Branchen – wie etwa in der Industrialisierung – aus, sondern von einem ganzen Brachnenkanon. Es geht also um nicht weniger als um künftige Wachstumsschübe für die deutsche Volkswirtschaft und die Prosperität Europas. Es geht um die Konkurrenzfähigkeit mit dem aufstrebenden Märkten – etwa in Indien und China. ... ist es nur eine Frage der Zeit, bis Europa von der Weltwirtschaft überholt wird.
 Terminologische Neuschöpfungen wie „Kreativwirtschaft“ befinden sich stets an der Kippe. Sie wirken leicht lächerlich und müssen oft lange wiederholt werden, bis sie sich eingespielt haben. Die Vorsitzenden der deutsche Musiklehrerverbände sind, wie schon gesagt, dieser Terminologie auf den Leim schnell gegangen. Vorarbeit hat die bereits zitierte Broschüre geleistet, die der SCHOTT-Verlag 2004 zusammen mit der GEMA, dem Dachverband der Deutschen Phonoindustrie und mit einer Empfehlung des Deutschen Musikrates /siehe Abbildung) kostenlos an alle Leser/innen der musikpädagogischen Zeitschrift „Musik & Bildung“ ausgegeben hat . Hier heißt es:
Terminologische Neuschöpfungen wie „Kreativwirtschaft“ befinden sich stets an der Kippe. Sie wirken leicht lächerlich und müssen oft lange wiederholt werden, bis sie sich eingespielt haben. Die Vorsitzenden der deutsche Musiklehrerverbände sind, wie schon gesagt, dieser Terminologie auf den Leim schnell gegangen. Vorarbeit hat die bereits zitierte Broschüre geleistet, die der SCHOTT-Verlag 2004 zusammen mit der GEMA, dem Dachverband der Deutschen Phonoindustrie und mit einer Empfehlung des Deutschen Musikrates /siehe Abbildung) kostenlos an alle Leser/innen der musikpädagogischen Zeitschrift „Musik & Bildung“ ausgegeben hat . Hier heißt es:
Deutschland lebt nicht von seinen Bodenschätzen. Weder Erdöl noch Kohle oder Diamanten sichern als Exportschlager unsere Volkswirtschaft. Es sind die Kreativen, die die Voraussetzungen für den Wohlstand von heute und morgen schaffen. ... Nicht Rohöl, sondern Gehirnschmalz ist der Rohstoff der Zukunft. Darauf setzen wir. (S. 2-3).
Allen, die „Musik & Bildung“ nicht abonniert haben, muss die Lektüre eines Buches mit dem Titel „Die Kreative Revolution. Was kommt nach dem Industriekapitalismus?“ nachhelfen . Hier lesen wir:
„Wir befinden uns in ganz Europa in einem Transformationsprozess. Der Titel dieses Prozesses lautet: Von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft und zu einer Kulturgesellschaft. ... Für Deutschland steht dabei die Kreativindustrie im Mittelpunkt. Sie muss Leitmarkt und damit Impulsgeber für die künftige Wertschöpfung werden. Dafür sind 3 Faktoren unabdingbar: Es geht um Respekt, um Mut und es geht um Fortschritt und Wandel... Ideen und Kreativität werden das wichtigste Wirtschaftsgut des 21. Jahrhunderts sein.“
Wie ist es zu der positiven Umwertung des Begriffs „Kulturindustrie“ zum Begriff „Kreativwirtschaft“ kommen? Ganz einfach dadurch, dass Kultur und eines ihrer Fermente, die Kreativität, zum Wirtschaftsfaktor erklärt und industriell produziert wird, ohne dass dies mehr anrüchig ist, weil Kultur und Kreativität keine gesellschaftskritische Funktion mehr haben oder haben sollen. Ein kleines „Creativity Self-Assessment“, das der Europäische Musikrat in der Winterausgabe 2009 seiner Zeitschrift „Sounds in Europe“ abgedruckt hat, macht dies deutlich.
Auf die „Frage“ A television team across the street wants to make an interview
|
2. Warum leuchtet es offensichtlich Kindern und Jugendlichen nicht spontan ein, dass die Gewinne der Musikindustrie mit einer Zunahme an kreativer Musik, an denen sie interessiert sein müssten, korrelieren?
Wie Dieter Gorny zu Recht bemerkt hat, haben Musiklehrer/innen und Schüler/innen beim kostenlosen Downloaden von Musik kein „ethisches“ Unrechtsbewusstsein. Die Ursachen sind einfach zu sehen:
Erstens verfolgen Musiklehrer/innen und Schüler/innen alle einen guten Zweck und dieser Zweck heiligt zumindest moralisch die Mittel. Solches ist insbesondere bei Musiklehrer/innen der Fall, die schon seit es Kopiergeräte gibt gnadenlos Schutzrechte am Xeroxapparat verletzen und dabei das nächste Schulkonzert oder schlicht ein schönes Arbeitsblatt im Unterricht vor Augen haben. Aber auch ein Mädchen, das die Songs einer angesagten Band kostenlos herunter lädt, freut sich an der Musik und nicht am „Betrug“.
Zweitens gehen die Alltagserfahrungen der Jugendlichen dahin, dass sie ein gesundes Misstrauen gegenüber der Musikindustrie hegen. Selbst in BRAVO steht geschrieben, dass unfähige Musiker/innen und Bands mit hohem Geldmitteleinsatz unschwer „nach oben“ gebracht werden können, dass selbstbewusste Stars wie Madonna ihre Plattenverträge als Knebelverträge bezeichnen und kündigten oder dass Musiker/innen an den Bindungen, die sie mit einem Konzern eingegangen sind, zerbrachen.
Drittens lässt sich die Ungerechtigkeit der industriellen Produktion von Musik leicht „nachrechnen“: ist jemand – banal gesagt – 10% „kreativer“ als ein anderer, so bekommt er einen Plattenvertrag, der andere aber nicht. Der eine erhält dann letztendlich für 2 Stunden Studioarbeitszeit einige Tausender oder mehr, der andere vielleicht 50 Euro an selbst gebrannten CD’s oder Konzerteintrittskarten.
Viertens leuchtet das Argument, dass Kreativität gesamtgesellschaftlich verloren ginge, wenn es die industrielle Produktion von Musik nicht gäbe, einfach nicht ein. Das Internet ist voll von guter Musik, die kostenlos auf diversen Plattformen angeboten wird. Warum sollten die Industrieprodukte „kreativer“ sein als vieles, was man sonst zu hören bekommt. Ist nicht das einzig Kreative an die bessere und professionellere Technik?
Spätestens bei dieser Frage kommt Einsicht, wenn nicht Neid und Ärger auf. Die narzisstische Befriedigung mit den Erfolgen und Einkünften des Stars, als „Identifikation mit dem Star“ in der Jugendpsychologie bezeichnet, lässt urplötzlich nach und weicht der Ernüchterung und Wut. Die unter dem Stichwort „Alles nur geklaut“ gezeigten Videoclips sollen provokant unprofessionell und gerade dadurch kreativ sein. Es macht großen Spaß, selbst etwas Unprofessionelles zu machen und zu zeigen, dass einem die perfekten Supershows nichts anhaben können.
Je mehr die Musikindustrie sich zum gesellschaftlichen Schützer des Kreativen aufbaut, umso skeptischer wird der Jugendliche und umso mehr sinkt sein Unrechtsbewusstsein. Der Terminus Kreativwirtschaft ist ein Bumerang, die dahinter stehende These ist ein fake. Und wird als solcher auch erkannt. Die erste und naheliegende Reaktion: jetzt gerade erst kostenloser Download von Industrieprodukten!
3. Warum soll der jugendliche Wunsch selbst kreativ zu sein und zu werden durch den Erwerb vorbildlicher Produkte der Kreativwirtschaft erfüllt werden? Wer oder was würde außer den Aktionären wirklich Schaden erleiden, wenn die Kreativwirtschaft ab sofort nur noch halb so viel produzieren würde?
 Die Kreativindustrie bittet, wie schon gesagt,
die Musikpädagogik, ihr bei der Förderung von „ethischem“ Unrechtsbewusstsein behilflich zu sein. Interessant ist,
wie sich Jürgen Terhag (Abbildung), Musikpädagogik-Professor an der Musikhochschule Köln, profilierter Vertreter
einer Popmusikdidaktik und Vorsitzender des eher „fortschrittlichen“ Musiklehrerverbandes AfS, zu Dieter Gornys Wünschen
äußert:
Die Kreativindustrie bittet, wie schon gesagt,
die Musikpädagogik, ihr bei der Förderung von „ethischem“ Unrechtsbewusstsein behilflich zu sein. Interessant ist,
wie sich Jürgen Terhag (Abbildung), Musikpädagogik-Professor an der Musikhochschule Köln, profilierter Vertreter
einer Popmusikdidaktik und Vorsitzender des eher „fortschrittlichen“ Musiklehrerverbandes AfS, zu Dieter Gornys Wünschen
äußert:
„Das wichtigste Ziel besteht im Wecken von kreativen Fähigkeiten bei Schülerinnen und Schülern und der daraus resultierenden Wertschätzung für kreative Leistungen anderer.“
Das ist ein interessantes gedankliches Konstrukt! Denn eigentlich müsste man meinen, je mehr die Schüler/innen selbst kreativ sind und sein können, umso eher sagten sie „das kann ich doch auch“. Wenn Jugendliche positive Gefühle beim aktiven Musizieren und Tanzen entwickeln, warum sollten sie dann zu Ehrfurcht vor jenen erzogen werden, die es geschafft haben, im Studio der Musikindustrie zu spielen und vor einer Fernsehkamera von VIVA zu tanzen?
Der Lernprozess, den sich Jürgen Terhag vorstellt, könnte nur dann funktionieren, wenn die Schüler/innen beim eigenen „kreativen“ Musikmachen merken, dass das, was sie selbst machen, in puncto Kreativität weit von dem entfernt ist, was die Kreativwirtschaft produziert. Aber sollte dies das Ziel von Musikmachen sein?
„Illegale Downloads aus dem Internet sind Teil der ethischen Steinzeit. Wenn Musikfans wüssten, was es bedeutet, auch nur einen einzigen Musiktitel zu produzieren, dann würden sie nicht auf die Idee kommen, Musikern ihr Einkommen zu verweigern.“
Mit der Bezeichnung „ethische Steinzeit“ sollen die Jugendlichen auf billige Art geködert werden, denn steinzeitlich will doch niemand sein? Allerdings, wie sieht die Sache aus, wenn man in der Steinzeit für dasselbe Taschengeld mehr bekommen hat als in der Neuzeit? Die „ethische Steinzeit“ ist aber in Wirklichkeit nicht vergangen, sondern bezeichnet die aktuelle Lage, unter der die Musikindustrie so schwer leidet. Die Aussage ist also keineswegs ehrlich, sondern allenfalls ein suggestiver Werbe-Slogan: „illegales Downloaden ist out, i-pod is in“. Werbung ist aber eigentlich nicht das Niveau von nachhaltiger Musikerziehung.
Musikfans wissen zudem sehr genau, wie viel Arbeit in der Produktion eines Musiktitels steckt. Sie wissen auch, dass bei einem guten Erfolg einer CD unterm Strich Stundenlöhne von 1000 bis 100 000 Euro herauskommen können. Und sie wissen auch, dass die Musiker etwa 5% von dem bekommen, was insgesamt beim CD-Verkauf über den Ladentisch wandert. Diese Zahlen stehen heute in allen Musiklehrbüchern – sie sprechen für sich. Nur nicht für das windige Argument Jürgen Terhags.
Wenn der Fan einen Titel eines verehrten Musiker kostenlos downloaded, so „verweigert“ er diesem Musiker nicht sein Einkommen. Er sagt sich und seinem Verehrten vielmehr: erstens verweigere ich den Aktionären der Musikindustrie ihre Dividende, zweitens zahle ich gerne einen guten Preis, wenn mein verehrter Musiker ein Konzert gibt, drittens dosiere ich mein Taschengeld durchaus auf gezielt ausgewählte Tonträger z.B. als Geburtstagsgeschenk und viertens habe ich meinen verehrten Musiker nie gezwungen, seine Musik über die Musikindustrie produzieren zu lassen, er hätte ja auch sich selbst im Internet vermarkten können, was mir sogar lieber gewesen wäre.
„Am meisten ärgert mich, dass in unserer Gesellschaft der Diebstahl geistigen und künstlerischen Eigentums parallel geht mit der Geringschätzung künstlerischer Leistungen.“
Der Begriff „Diebstahl“ ist, wie schon erörtert, sachlich falsch. Zwar hat sich die Vorstellung eines „geistigen Eigentums“ seit der frühen bürgerlichen Gesellschaft im gesellschaftlichen Bewusstsein fest gesetzt. Es ist aber selbst bei der Erfindung der GEMA durch Richard Straus stets eine Metapher gewesen. Wenn ein Musiker ein Musikstück komponiert oder – moderner – als CD produziert, dann nützt ihm der bloße Besitz dieses Produkts („Eigentum“) nicht. Er muss Kopien des Produkts verkaufen oder – im Falle einer traditionellen GEMA-pflichtigen Komposition – von Musikern aufführen lassen.. Unsinnig ist jedoch der Begriff „Diebstahl“, weil es sich beim kostenlosen Anhören von Musik allenfalls um die Nichtbeteiligung an der Bezahlung der Dienstleistung des Musikers handelt.
Dass der Begriff des geistigen Eigentums ein ideologischer Begriff ist, wird seit langem intensiv diskutiert. Aus dem Internet können ausführliche historische, juristische und philosophische Abhandlungen über den historischen Charakter dieser Denkform kostenlos herunter geladen werden. Der Begriff war ein Kampfbegriff, unscharf und deshalb erfolgreich . Er war beim Aufkommen der Warengesellschaft wichtig, weil dort Dienstleistungen wie Musikmachen Warencharakter angenommen haben. Aber, wie gesagt, das hat nie vollständig geklappt. Musik blieb stets im Kern eine Dienstleistung, die sich nur als Kopie in eine Ware verwandeln konnte. Perfide ist daher, wenn in musikpädagogischen Publikationen suggeriert wird, der Diebstahl eines Gegenstandes (beispielsweise vom besten Freund) sei vergleichbar mit dem kostenlosen Download der Musik eines verehrten Pop-Idols.
Wenn sich die Kreativwirtschaft zum Hüter geistigen Eigentums aufschwingt, so ist das doppelt verlogen. Denn gerade sie ist es, die die Kreativität eines Musikers und seine Ideen ausbeutet und vermarktet. Der Sinn eines jeden „Plattenvertrages“ ist es, dass juristisch der Musiker sein „Eigentum“ aus der Hand gibt. Was er für sein ehemaliges „Eigentum“ bekommt, sind wenige Prozent Gewinnbeteiligung an der industriellen und kapitalistischen Verwertung desselben. Aber noch schlimmer, er kann sein „geistiges Eigentum“ ja gar nicht so produzieren, wie er es möchte. Er muss es in die Form gießen, die die industrielle Verwertung vorsieht.
4. Warum soll ein industrielles Lied, nur weil es technisch perfekt zu sein scheint, kreativer sein als ein selbstgemachtes Lied, das es niemals zu einem Plattenvertrag bringen wird, das aber mit großem Spaßfaktor vor Freunden aufgeführt und einer virtuellen Fangemeinde vorgeführt werden kann?
Diese Frage spricht eigentlich für sich. Denn jeder musikalisch auch nur ansatzweise aktive Mensch bemerkt sehr schnell, dass die Musikindustrie einen Kreativitäts-Begriff verwendet, der sich nicht mit dem deckt, was man als musikalisch Tätiger unter Kreativität versteht. Die Kreativität, die die Musikindustrie meint und um die sie sich Sorgen macht, bemisst sich ja überwiegend am Absatz der Produkte und somit am Erfolg der produzierten Musik. Alle Produkte müssen sich minimal voneinander unterscheiden und doch für den Käufer kategorial einordenbar sein – „neu und doch bekannt“ ist die Formel. In diesem Rahmen spielt sich industrielle Kreativität ab. Dabei hat die Industrie genuin gar kein Interesse, ständig Neues zu produzieren, solange die Reproduktion von Altem sich gut verkauft. Am meisten verdient sie durch Wiederholung des Immergleichen, schwieriger wird es schon bei der Variation von Bekanntem. Und die Förderung von gänzlich Unbekanntem ist ein randständiges Phänomen, das sich die verschiedenen Musikkonzerne aus Konkurrenzgründen leisten müssen.
 Wenn man den Begriff Kreativität durch Professionalität ersetzt, dann würde die Argumentation der Musikindustrie schon eher stimmen. Sieht man sich die Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ an, so wird man bemerken, dass hier – beispielsweise mit dem unsäglich trivialen und altmodischen Bohlen-Song in der Endausscheidung April 2010 – nicht Kreativität im Sinne von etwas Neuem, sondern einfach nur Professionalität abgefragt wird. Die „Kandidaten“ werden extrem gefordert, müssen stilistisch unterschiedliche Titel singen und vor allem eine perfekte Performance haben. Da ist im Grunde keinerlei Kreativität mehr vorhanden und niemand würde DSDS dadurch definieren, dass hier Kreativitätspotentiale gefördert würden.
Wenn man den Begriff Kreativität durch Professionalität ersetzt, dann würde die Argumentation der Musikindustrie schon eher stimmen. Sieht man sich die Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ an, so wird man bemerken, dass hier – beispielsweise mit dem unsäglich trivialen und altmodischen Bohlen-Song in der Endausscheidung April 2010 – nicht Kreativität im Sinne von etwas Neuem, sondern einfach nur Professionalität abgefragt wird. Die „Kandidaten“ werden extrem gefordert, müssen stilistisch unterschiedliche Titel singen und vor allem eine perfekte Performance haben. Da ist im Grunde keinerlei Kreativität mehr vorhanden und niemand würde DSDS dadurch definieren, dass hier Kreativitätspotentiale gefördert würden.
Das Phänomen „Lena“ hat gezeigt, dass eine Quereinsteigerin ganz ohne kreativitätsfördernde Maßnahme den Eurovisions-Preis gewinnen kann. Die gezielt unprofessionelle Performance und Stimme (z.B. schlenkert Lena in der Osloer Endausscheidung wie ein Kleinkind ein paar Mal unkontrolliert mit den Händen oder hebt wie ein Hündchen ein Bein an) hat die Herzen der Zuschauer/innen erobert. Freilich hat die Kreativwirtschaft inzwischen zugeschlagen und aus Lena ihren Profit herausgeholt..
Video 2: Mehrzad und Lena
Vielleicht tue ich der Kreativwirtschaft Unrecht, wenn ich das Attribut „kreativ“ auf einzelne Menschen oder Produkte anwende. Vielleicht denkt die Musikindustrie eher in globalen oder gesamtgesellschaftlichen Kategorien und kann dies selbstverständlich nur unter der Formbestimmung des Kapitalismus tun. Vielleicht denkt die Musikindustrie gar nicht daran, dass ihre Mitarbeiter/innen kreativ sind und handeln. Vielleicht denkt sie einfach daran, wie sie aus Individuen, deren Schicksalen, deren Gefühlen und natürlich auch deren musikalischen Fähigkeiten ein Produkt formt, das massenweise gekauft wird. Vielleicht ist die Musikindustrie deshalb eine Kreativwirtschaft, weil sie aus den Ingredienzien Individuum, Schicksal, Gefühl und Musikalität ein Massenprodukt herzustellen in der Lage ist. Vielleicht sagt sie einfach: Wenn wir das nicht exemplarisch machen würden, dann gäbe es all‘ diese Massenprodukte nicht, dann ginge einfach etwas verloren, was doch massenhaft gekauft wird.
Ich unterstelle also der Kreativwirtschaft, dass sie nicht um den nackten Selbsterhalt kämpft wie es v.e.r.d.i. sub specie Arbeitsplätze tut sondern weil sie der Überzeugung ist, dass sie bedeutsam, wichtig und notwendig, wenn nicht sogar („ethisch“) gut ist. Wenn aber schon von Ethik die Rede ist, dann muss die Art und Weise, wie die Kreativindustrie Individuen, Schicksale, Gefühle und Musikalitäten zu Massenprodukten formt, auch unter ethischen Gesichtspunkten analysiert werden. (Und meines Erachtens müssten Musiklehrer/innen solches auch mit ihren Schüler/innen gemeinsam tun.)
Im habe im Februar 2010 auf La Palma in vier Zeitschriften ähnlich lautende Texte über die Soulsängerin Corinne Bailey Rae gelesen – und zwar in deutschen und spanischen Zeitschriften, in Frauen-Modemagazinen und Fernsehzeitschriften . Den diversen Artikeln lag offensichtlich eine Presseerklärung und ein Foto zugrunde, das in variierter Form in den Zeitschriften aufgegriffen wurde. Die Kreativindustrie hat aus der Tatsache, dass der Ehemann der Sängerin just als sie dabei war den Erfolg ihrer ersten CD zu feiern bei einer anderen Party aufgrund von „Drogenexperimenten“ „sofort starb“, eine CD geformt. Die Sängerin, so der Werbetext, „stürzte in ein schwarzes Loch“, sie „gibt aber nicht auf“. Weitere Geschichten, die die Grausamkeit des Schicksals darstellen, werden erzählt. Dann jedoch wird Corinne kreativ: im Studio produziert sie „berührende Songs, verarbeitet alle Trauer, gießt sie in Lieder“, der „quirlige Charme der alten Songs ist einer rauen, schonungslosen Intensität gewichen, die jeden Hörer direkt ins Herz trifft“, und so weiter. Dabei haben der Sängerin „bei aller Trauer“ „die Liebe und der Halt meiner Freunde“ geholfen. Die Fan-Gemeinde soll leben! Fazit: „I'm really aware that I can't hide any of my feelings“. Kreativ ist hierbei nicht so sehr die Verwandlung von Trauer in Musik, denn dies ist absoluter Musik-Standard sein Menschengedenken. Kreativ ist die Werbestrategie, mit der das Produkt „The Sea“ vermarktet wird und die erahnen lässt, wie dabei die beteiligten Menschen und deren Gefühle in einer Schmierentragödie untergehen. Man kann nur hoffen, dass, falls sich Corinne Bailey Rae wirklich in einem „schwarzen Loch“ befunden hat, sie mit den zitierten Freunden zusammen Soul gesungen hat, ohne dass ein Vertreter der Kreativindustrie zuhören durfte. – Das Pressefoto:
 Gegenüber dieser eher spießigen Werbekampagne ist das Verkaufsnetz des Musikkonzerns EMI auf dem aktuellsten Stand. Über die Homepage der Sängerin bekommt man Zugang zu vielfältigen Produktvarianten. Bei Amazon wird die ganze CD um 9 Euro angeboten oder um 12,99 frei Haus (9 Euro entsprechen einem Ladenpreis von 15 Euro), man kann jeden Titel der CD auch einzeln um 89 Cent als mp3 downloaden, als i-tunes um 99 Cent pro Titel. Corinne ist auf den Plattformen MySpace, facebook, twitter, iLike, lost fm und Youtube vertreten. Ferner ist sie bei „Creative Cooperation“ aufgeführt. Bei Youtube befinden sich alle „offiziellen“ Videos, die auch über die Homepage zu erreichen sind, zahlreiche „Illegale“ Fan-Videos ferner ein Video von „The Guardian“, in dem Corinne sehr sachlich über den ersten Titel der neuen CD spricht :
Gegenüber dieser eher spießigen Werbekampagne ist das Verkaufsnetz des Musikkonzerns EMI auf dem aktuellsten Stand. Über die Homepage der Sängerin bekommt man Zugang zu vielfältigen Produktvarianten. Bei Amazon wird die ganze CD um 9 Euro angeboten oder um 12,99 frei Haus (9 Euro entsprechen einem Ladenpreis von 15 Euro), man kann jeden Titel der CD auch einzeln um 89 Cent als mp3 downloaden, als i-tunes um 99 Cent pro Titel. Corinne ist auf den Plattformen MySpace, facebook, twitter, iLike, lost fm und Youtube vertreten. Ferner ist sie bei „Creative Cooperation“ aufgeführt. Bei Youtube befinden sich alle „offiziellen“ Videos, die auch über die Homepage zu erreichen sind, zahlreiche „Illegale“ Fan-Videos ferner ein Video von „The Guardian“, in dem Corinne sehr sachlich über den ersten Titel der neuen CD spricht :
Video 3: Corinne Bailey Rae
Die Kreativindustrie bedient im Falle von Corinne fast alle Plattformen, die heute unter „Selbstvermarktung“ subsumiert werden. Mit einem wichtigen Unterschied, sie bedient diese Plattformen nicht selbst, sonder lässt das von einem professionellen Team ihres Managements erledigen.
5. Warum soll die industrielle und multinationale Fremdvermarktung von Musik mehr dem Schutz von Kreativität dienen als das verzweigte System der Selbstvermarktung von Musik im Internet?
Das Internet hat dem Live-Konzert wieder einen starken Auftrieb gegeben. Der Umsatz an Live-Konzerten übersteigt seit 2007 den der Tonträger. Das bedeutet, dass die direkte Dienstleistung „Musik“ wieder wichtiger wird als der Warenkonsum. Das Argument, Konzerte seien lediglich Werbemaßnahmen für den CD-Verkauf, hat sich umgekehrt: „Irgendwie könnte man sagen, der Künstler der Jetztzeit wird durch die Digitalisierung der Musik wieder auf seine ursprüngliche Bestimmung der Musik zurückgebogen“ – das Musizieren für andere, die Dienstleistung.
Für jeden Musiker und Musikpädagogen müsste diese Tendenz hoch erfreulich sein. Umso erschreckender ist es, wenn diese Tendenz nicht gefördert, sondern angesichts der angeblichen Misere der Musikindustrie bejammert wird. Im mittleren und unteren Musiksektor, in dem sicherlich die meisten Musiker/innen beschäftigt sind, steht der Live-Auftritt mit dem CD-Verkauf in der Pause und am Ende des Auftritts ganz im Zentrum der „Selbstvermarktung“. Die CD dient hier als Erinnerung an einen schönen Abend. Das ist vielleicht ihre beste Bestimmung seit der Erfindung des Phonographen.
Die „Selbstvermarktung“ von Musikern ist der eigentliche Feind und Konkurrent der Kreativwirtschaft.
Hier tobt die blanke Kreativität auf allen nur denkbaren Qualitätsstufen zum Nulltarif für Musiker und Hörer. Das Selbstvermarktungsfieber hat bereits klassische Orchester erfasst:
Madonna, „Radiohead“ oder der Rapper „Jay-Z“ haben ihre herkömmlichen Plattenverträge gelöst. Die Produktionskosten für CD’s sind enorm gesunken. Soeben ist die zweite Auflage des Buches „Selbstvermarktung für Musiker“ von Jörn Kachelrieß erschienen. In diesem Buch werden alle Plattformen diskutiert, auf denen sich Musiker/innen selbst vermarkten können. Das geht meist so ab, dass der Betreiber der Plattform den Verkauf von CD’s übernimmt oder einen Verkaufsakt des Musikers arrangiert. Mit relativ bescheidenen Gebühren wird man auf der Plattform präsentiert und beim Verkauf geht ein Prozentanteil von 5 bis 10% an den Betreiber. Der Musiker lässt die Tonträger bei einem Label herstellen oder druckt und presst sie einfach selbst. Die Auflagen richten sich nach Nachfrage („on demand“). Analoges gilt für Download-mp3-Dateien.
Da dies Vertriebssystem so extrem einfach, übersichtlich und ohne großes Risiko ist, wird es natürlich von zahlreichen Musiker/innen genutzt, sodass das Gesamtangebot noch unübersichtlicher ist als das Sortiment eines Plattenladens. Es ist also wichtig, dass der Musiker sich zusätzlich „irgendwie“ bekannt macht. Der beste Weg hierzu sind lokale Konzerte, eine lokale Fangemeinde und darauf aufbauend ein „soziales Fan-Netz“.
Die Funktionsweise der „Selbstvermarktung“ habe ich punktuell getestet:
(1) Ein Musikerkollege von mir hat sich von einer amerikanischen Firma 200 Adressen von Vertrieben und Veranstaltern gekauft, die seinem musikalischen „Profil“ entsprachen. Es erfolgten 2 Nachfragen und ein Kontakt nach Kalifornien. Als „globaler“ Vertrieb funktioniert diese Selbstvermarktung also wohl nicht.
(2) Die Stuttgarter Rockgruppe „tut das not“ gibt Konzerte und führt eine Homepage, über die man CD’s bestellen kann. Sie ist mit amateurhaften Videos massiv in Youtube vertreten. Allerdings gelangt man zu diesen Videos nur, wenn man den Namen der Gruppe kennt. Über allgemeine Suchbegriffe findet man im Meer der ähnlich präsentierten Gruppen nichts. Die Bestellung einer CD kostet 8 Euro plus 1,20 Porto underfolgt direkt bei einem der Musiker. Die CD’s sind bei einem Label professionell hergestellt, was bei Auflagen von 300 ungefähr 1000 Euro kostet. Da die Band primär Auftritte abarbeitet und die Musiker nicht vom Musikmachen leben müssen, geht die idealistische Gesamtrechnung dieser politisch engagierten Gruppe gut auf. Die CD befindet sich zudem noch in einem alternativen Vertrieb „NIX.GUT.DE“.
(3) Dass bei der Selbstvermarktung letztendlich das Live-Event eine Schlüsselfunktion hat, zeigt ein weiteres Beispiel: Ich habe zusammen mit dem Obertonsänger Reinhard Schimmelpfeng die DVD „Schimmelpfengs Obertonschule“ produziert. Das Label starfish in Bremen stellte 300 DVD’s mit Booklet und allem drum und dran her. Reinhard Schimmelpfeng vertreibt die DVD auf Workshops, die er landauf landab gibt. Nach 8 Monaten hatte er 120 DVD’s verkauft und damit alle Produktionskosten abgegolten, die restlichen 180 DVD’s dürften in 2 Jahren verkauft sein und einen „Gewinn“ von 2400 Euro einbringen.
Zwei Gegenbeispiele zeigen die vielfältigen Probleme bei „Fremdvermarktungen“:
(1) Zusammen mit Melanie Meinig habe ich eine Lehr-DVD über Capoeira gedreht und programmiert. Ein Schulbuchverlag hat das Material übernommen, als fertige DVD produzieren lassen und vertreibt es. Er hat im ersten Jahr kräftig Werbung gemacht, die Musikzeitschrift seines Verlages ist im deutschsprachigen Raum die auflagenstärkste. Ich schrieb einen redaktionellen Artikel. Ergebnis: 70 verkaufte Exemplare in einem Jahr mit 10% Honorar für die beiden Autor/innen, also 140 Euro.
(2) Vor 10 Jahren habe ich zusammen mit Markus Kosuch einen Methodenfilm der szenischen Interpretation von Musiktheater gedreht. Der Film wurde von einem Verlag, in dem auch die Printprodukte der szenischen Interpretation erscheinen, als VHS-Cassette vertrieben. Im Frühjahr stand eine Neuauflage des gedruckten Methodenkatalogs an, die wir zum Herbst 2009 als pdf druckreif hergestellt hatten. Zudem hatte ich den Inhalt der VHS-Cassette digitalisiert und als DVD programmiert. Ich hatte vorgeschlagen, dem gedruckten Buch die DVD beizulegen. Da das Kopieren einer fertigen DVD etwa 2 Euro kostet ist solch eine Beilage mit großem Gewinn für Leser und Verlag verbunden ... Denkste! Die Rechte an digitalen Tonträgern sind andere als an den „analogen“. Zudem hat sich die Rechtslage verändert. Auf dem Methodenfilm von 60 Minuten Dauer erklingen zwar nur 4 Minuten Musik von einer kommerziellen CD im Hintergrund. Dies gilt als Filmmusik und zählt besonders viel, nämlich 1600 Euro. Dieser Betrag würde die DVD-Beilage so verteuern, dass der Verlag abgewunken hat. Derzeit wird nun diskutiert, keine DVD beizulegen, die DVD ganz ohne Musik zu produzieren und/oder dass ich die DVD im selbst vermarkte und der Verlag für sein Printprodukt von mir eine Lizenz bekommt.
Solche Situationen sind grotesk und mit Sicherheit alles andere als ein Ruhmeszeichen für die Kreativwirtschaft. Die von uns verwendete CD enthält Musik des Komponisten Leonard Bernstein, dessen Nachkommen allein aufgrund der Aufführungsrechte an der West Side Story sich eine goldene Nase verdienen. Zudem stellt sich die Frage, ob dieser Goldsegen nicht noch vermehrt würde, wenn viele Schüler/innen aufgrund der DVD und der szenischen Interpretation der West Side Story animiert würden, mal in die Oper zu gehen. Solche Überlegungen, die ich schon dutzendweise in leidigen Diskussionen mit Verlegern vorgetragen habe, zeigen, wie es mit der denkenden Kreativität der Kreativwirtschaft bestellt ist. Letztere kennt nur sture Mechanismen und hat keinerlei strategischen Weitblick.
Ich bekenn daher frank und frei: Ich werde solange im Twiskenstudio CD’s und DVD’s produzieren und vertreiben, werde solange und so viel ins Netz stellen und und aus dem Netzt downloaden bis mich jemand von der Kreativität der Kreativwirschaft überzeugt hat.
FAZIT
Mich empört nicht, dass die Musikindustrie Wege sucht, ihren Profit zu maximieren, und ihr dabei alle nur denkbaren Argumentationen gerade Recht sind.
Mich empört auch nicht, dass im aktuellen Kreislauf der Drittmittelvergabe an einer Musikhochschule ein Forschungsprojekt durchgeführt wird, das keine Fragestellung hat, die es beantworten will, sondern ein Ziel verfolgt, das von vornherein feststeht, und damit die „Forschungsfrage“ nur noch lautet, ob sich das vorgesetzte Ziel auch erreichen lässt. Da die meiste Drittmittel- und Industrieforschung nicht mehr ergebnisoffen und daher nicht mehr im herkömmlichen Sinne von Wissenschaft seriös ist, kann mich auch das Forschungsprojekt „PlayFair – Respect Music“ nicht aus der Fassung bringen.
 Obgleich mich der Kapitalismus als solcher schon zur Raserei bringen kann, empört mich nicht mehr, dass so gut wie alle Menschen in Deutschland die immanenten Gesetze der Kapitalverwertung verinnerlicht haben und nicht mehr willens sind alternativ zu denken. So wie das Wort „Kapitalismus“ vor einigen Jahrzehnten ein Schimpfwort war und heute zum terminus technicus geworden ist, ist ja auch das Wort „Kulturindustrie“ in der skurrilen Form von „Kreativwirtschaft“ ein nicht mehr hinterfragter terminus technicus. Schon vor 13 Jahren hat ein US-amerikanischen Journalist diese positive Umwertung unter der Bezeichnung „Verschwinden des Generationskonflikts“ auf den Punkt gebracht (Abbildung).
Obgleich mich der Kapitalismus als solcher schon zur Raserei bringen kann, empört mich nicht mehr, dass so gut wie alle Menschen in Deutschland die immanenten Gesetze der Kapitalverwertung verinnerlicht haben und nicht mehr willens sind alternativ zu denken. So wie das Wort „Kapitalismus“ vor einigen Jahrzehnten ein Schimpfwort war und heute zum terminus technicus geworden ist, ist ja auch das Wort „Kulturindustrie“ in der skurrilen Form von „Kreativwirtschaft“ ein nicht mehr hinterfragter terminus technicus. Schon vor 13 Jahren hat ein US-amerikanischen Journalist diese positive Umwertung unter der Bezeichnung „Verschwinden des Generationskonflikts“ auf den Punkt gebracht (Abbildung).
Als musikpädagogisch engagierter Mensch jedoch beunruhigt mich, dass führende und anerkannte Musikpädagogen sich so platt vor den Karren der Industrie spannen lassen und dabei Ideen entwickeln, die ausgesprochen schülerfeindlich sind, scheinheilig und zynisch. Der zu erwartende Widerstand der Schüler/innen gegenüber dem, was hier die Musikpädagogik im Bunde mit der Kreativwirtschaft im Schilde führt, ist mein einziger Hoffnungsschimmer:
Die Schüler/innen werden den „Großen Schwindel“, so der Buchtitel über die Musikindustrie aus den 1980er Jahren, einfach bemerken. Kreativer Musikunterricht - es möge ihn massenhaft geben! – wird nicht die Ehrfurcht vor den Machenschaften des Kapitalismus, dem Warencharakter von Musik und den Kampagnen der Industrie-Bosse steigern, sondern individuelles Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Kritikvermögen, kurz Kreativität. Bei der Diffamierung des kostenlosen Dowloadens als „Diebstahl“ wird kein Unrechtsbewusstsein sondern Empörung aufkommen. Der Versuch, Ehrfurcht vor dem hohen Kreativitätspotential der „Großen Stars“ und dem enormen technischen Aufwand, den eine CD-Produktion erfordert, zu erzeugen wärmt nicht nur die längst überholte „Genie-Pädagogik“ wieder auf. Die Schüler/innen werden auch klare Fragen stellen: Wo bleiben die Gewinne der Musikindustrie, wie viel bekommt der kreative Musiker für seine Studioarbeit und wie kreativ sind die Aktionäre der Musikkonzerne, wie kreativ sind Plattenverträge, die Künstler an eine Firma jahrelang binden, warum gibt es so viel aufregende, interessante und kreative Musik kostenlos auf den diversen Plattformen des Internets, warum gehen immer mehr kreative kleine und große Musiker/innen den Weg der Selbstvermarktung – durch Gründung unabhängiger Labels oder via Internet? Und ist eigentlich meine Kreativität so viel weniger Wert als die der Musikindustrie?
Jeder Unterricht, der das Thema „Kreativwirtschaft“ den Tatsachen entsprechend thematisiert, wird glücklicherweise zum Bumerang für die Musikindustrie, weil deren Argumentation so gut durchschaubar ist. Und das ist das Schöne an dieser unehrlichen, von Verlogenheit strotzenden Kampagne. Ich wünsche der Kreativwirtschaft die Große Krise im Interesse der vielen Schüler/innen, deren Kreativität durch guten Musikunterricht gefördert worden ist, im Interesse aller kreativer Musik!
Zitierte und verwendete Literatur
- Ahlers, Michael und Tobias Vogel: Selbst ist die Band. Konzepte, Beispiele und Reaktionen auf die künstlerische Selbstvermarktung im Internet. In: Musik und Unterricht Heft 91. Lugert-Verlag, Oldershausen 2008.
- Bernuth: Neue Regeln für den Unterrichtsalltag durch das Urheberrechts. In: Musik & Bildung. Spezial 2005. Thememheft „Wert der Kreativität“. Schott, Mainz 2004, S. 54-57.
- Europäischer Musikrat/European Music Council: SOUNDs in Europe. Newsletter Winter 2008/09. Themenheft „Creativity & Innovation“.
- Kachelrieß, Jörg: Selbstvermarktung für Musiker. Strategien für Bandkonzeption, Onlinepräsentation, Eigenvertrieb und Guerilla-Marketing. PPV-Medien, Bergkirchen 2010.
- Hufner, Martin: Halbvolle Gläser, gepriesene Musikautoren. Jahrespressekonferenz der GEMA. In: Neue Musikzeitung 5/2010, S. 13.
- Lotter, Wolf: Die kreative Revolution. Was kommt nach dem Industriekapitalismus? Murmann Verlag, Hamburg 2009.
- Raunig, Gerald: Kreativindustrie als Massenbetrug. Übersetzt von Jens Karstner. In: eipcp (europäisches institut für progressive kulturpolitik) 01/2007. http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/de (22.5.2010)
- Stoll, Rolf W., Herwig Geyer und Hartmut Spiesecke: Nicht Rohöl, sondern Gehirnschmalz. In: Musik & Bildung. Spezial 2005. Thememheft „Wert der Kreativität“. Schott, Mainz 2004.
- Stoll, Rolf W.: „den wert der schöpferischen leistung wieder stärker in den vordergrund rücken“ Olaf Zimmermann im Gespräch mit Rolf W. Stoll. In: Neue Zeitschrift für Musik 2/2007, S. 10-13. (Olaf Zimmermann ist Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Rolf W. Stoll ist Redakteur im Schott-Verlag.)
- Stroh, Wolfgang Martin: Die Idee des geistigen Eigentums als bürgerliches Relikt. In: Neue Musikzeitung 6/2008, S. 13-14.
- Terhag, Jürgen: „PlayFair – Respect Music“. In: AfS-Magazin 27, Mai 2009, S. 36-37.
- Terhag, Jürgen: „Die Musikpädagogik ist in der musikalischen Realität angekommen“ Ein Gespräch mit Prof. Dieter Gorny über Urheberrecht im Unterricht. In: AfS-Magazin 27, Mai 2009, S. 38-41.
