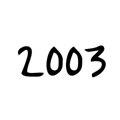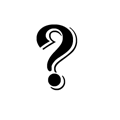(Refrain:) „Enge, enge Gassen, in denen Mädchen Murmeln spielen" (Türkisches Volkslied)
In den zwei Kulturen, in denen ich aufgewachsen bin,
ziehen meine lieben Schwestern meist den kürzeren,
weil nicht nur zwei Kulturen aufeinander krachen,
weil auch Väter über ihre Töchter wachen...
Ja, ja nun nehme ich mir die Freiheit
Aziza-A tut, was sie für richtig hält,
auch wenn sie aus den Augen der ganzen Sippe fällt...
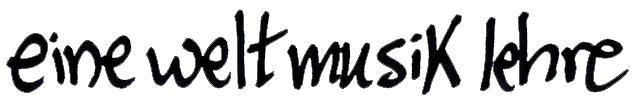
Aus einem Votrag beim Arbeitskreis Musipädagogische Forschung 1999:
Begründung und Problematisierung eines notwendigen Projekts
In die Begründung fließen die Ergebnisse von drei Forschungsvorhaben ein: (1) eine Studie zur multikulturellen Situation des außergewöhnlichen US-Bundesstaates Hawaii, (2) eine Erhebung zur Repräsentation „fremder Kulturen" im herrschenden deutschen Musikleben, insbesondere an Niedersächsischen Musikschulen, und (3 eine vergleichende Studie zur multikulturellen Musikerziehung BRD/USA.Multikulturalität als Zusammenleben „monokultureller Individuen"Die klassischen Konzepte der multikulturellen Gesellschaft gehen davon aus, daß Menschen unterschiedlicher Kulturen in einem Gemeinwesen zusammenleben und sich vertragen. In den USA ist man beispielsweise, nachdem die Soziologie der 50er Jahre die Idee des „Melting Pot" empirisch widerlegt hatte, dazu übergegangen, als Ziel der multikulturellen Gesellschaft die friedlich-demokratische Regulierung von Differenzen zu formulieren. Man hat in diesem Zusammenhang „ethnicity" (im Sinne von „kultureller Identität") definiert. Im Grunde ist bei diesen Konzepten weder von Bedeutung,
- warum Menschen unterschiedlicher Kultur in einem Land zusammen leben, noch
- ob die Beteiligten das wollen, ja nicht einmal
- ob sie den gesellschaftlichen Zustand wahrhaben wollen, noch
- ob sie dies alles gut oder schlecht finden.
- Die musikethnologisch ausgerichtete Konzeption (z.B. Helms), die für das authentisch Fremde interessieren möchte, ohne die Grenzen im Sinne der verabscheuten World Music zu verwischen, oder
- die Konzeption der interkulturellen Kommunikation (z.B. Merkt), die entlang von „Schnittstellen" die Begegnung unterschiedlicher Individuen und Kulturen musikalisch vor allem in ethnisch gemischten Schulklassen organisieren möchte, oder>
- die Konzeption der interkulturellen Musikerziehung als eines „Weges zum Eigenen" (z.B. Schütz), der von allen in Deutschland ausgebildeten SchülerInnen beschritten werden sollte.
Multikulturalität als Zusammenleben „multikultureller Individuen"
In der einschlägigen Fachdiskussion wird das Konzept der „(mono-)kulturellen Identität" seit 1986 Jahren in Frage gestellt. Ich verweise auf die gute Gesamtdarstellung bei Georg Auernheim und die Definitionen des europäischen „Directorate for Education, Culture and Sport" DECS/EGT:
„Culture is the result of the creative attitude of individuals towards reality. ...it [the individual] selects what is to be used and what is to be rejected, in a learning process" (S. 41).Ich möchte im folgenden einige musikrelevante Aspekte benennen. Auch die Musikforschung hat Beobachtungen zusammengetragen, die es angezeigt erscheinen lassen, das beschriebene Konzept von Multikulturalität aufzugeben.
(1) Im Bereich subkulturellen Verhaltens ist das Phänomen „multikultureller Indentitäten" seit einiger Zeit bekannt. Drei signifikante Beispiele:
Heiner Gembris stellte anläßlich einer Musikpräferenzen-Untersuchung für den Rundfunk fest, daß es „die" Musikpräferenz nicht gibt. Menschen präferieren vielmehr je nach Tageszeit, Verfassung, Intention oder Tätigkeit relativ bewußt unterschiedliche Arten von Musik. Die pädagogisch verbreitete, von Hartwig-Wiechel bis zur STERN-Demoskopie suggerierte Auffassung monokultureller Menschen, die entweder Marschmusik- oder Opern- oder Beat-Liebhaber seien, ist offensichtlich unhaltbar. Menschen sind eher danach zu unterscheiden, welche Strategien sie beim Umgang mit Musik verfolgen. Eine auf solchen Unterscheidungen beruhende Kategorisierung wird gemeinhin nicht als „Kultur" bezeichnet. Klaus-Ernst Behne hat in Hannover festgestellt, daß Musikstile nicht ein-eindeutig jugendkulturellen Szenen zugeordnet werden können. Zur Charakterisierung einer Szene (= Jugendsubkultur) ist neben der präferierten Musik auch wichtig, welche Musik abgelehnt wird und gegenüber welcher Musik die Betroffenen gleichgültig sind. Der einzelne Jugendliche sympathisiert mehr oder minder mit verschiedenen Szenen. Nur wenige rechnen sich „monokulturell" zu einem harten Kern, und selbst die lassen sich die Option offen, Teile anderer Szenen in ihren Lebensalltag zu integrieren. Die Medienpädagogik hat mit dem Begriff „Medienkompetenz" diese Supermarkt-Strategie, wonach sich jeder aller kulturellen Versatzstücke bedient, die er erreichen kann, ins Positive gewandt. Eine Übertragung des Konstrukts „Medienkompetenz" auf die Musik(pädagogik) steht zwar noch aus. Es leuchtet aber unmittelbar ein, daß hier das Auswählen aus dem medial vermittelten kulturellen Supermarkt nicht nur als Inbegriff postmoderner Gleichgültigkeit, sondern als eine neue Art von Aneignungs-Kultur interpretiert wird.
(2) Es gibt keinen Grund, diese positive Wende nicht auch mit Bezug auf die ethnisch bedingte Multikulturalität zu vollziehen. Die Vorstellung, daß ethnische Kulturalität „tiefer" sitzt als subkulturelle, ist zwar plausibel, sind doch die sozialen Nah-Instanzen, die Abweichungen oder kulturelle Ausbrüche zu behindern versuchen, das eine Mal die Familie, das andere Mal die Peer-Group. Aus Sicht der Betroffenen, vor allem der Jugendlichen selbst jedoch, ist zweifelhaft, ob die Familie (beispielsweise in der Pubertät) psychisch „tiefer" reicht als die Peer Group. Auch im Bereich der ehtnischen Multikulturalität gibt es zahlreiche Beobachtungen, die gegen monokulturelle Identitäten sprechen. Hier einige musikbezogene Beispiele, Beobachtungen und Fakten: Karin Pilnitz 1996 referiert eine Untersuchung in vier Regionen der Bundesrepublik zu Musikvorlieben ausländischer SchülerInnen. In der Schule nach Lieblingsmusik befragt antworten diese Kinder und Jugendlichen kaum unterscheidbar von ihren deutschen KlassenkameradInnen. Auf Nachfrage jedoch kennen und lieben sie „selbstverständlich" traditionelle (z.B. türkische oder kurdische) Musik. Sobald sie nach ihren Vorstellungen über Musikunterricht befragt werden, sagen die meisten, daß ihre traditionelle Musik zu Hause eine festen Stellenwert, in der Schule jedoch nichts verloren habe. „Ich soll immer kurdische Lieder singen oder etwas aus Kurdistan erzählen, dabei bin ich da gar nicht so oft gewesen. Die Deutschen müssen nie Lieder singen. Zu Hause singe ich gern, ich spiele Saz, aber in der Schule macht mir das keinen Spaß". Diese Kinder und Jugendlichen zeigen sich bewußt „multikulturell" - in der Schule so, zu Hause anders. Und dies ganz ohne Probleme.
Die deutsch-türkische Sängerin Aziza-A, die für Berliner Türk-Rap-Firmen CD’s produziert hat, sagt und singt ganz programmatisch, daß sie gerne in zwei Kulturen lebt.
Sie will sich aus der deutschen und aus der türkischen Kultur die Elemente herausgreifen, die sie gut findet. Das Mitleid, das PädagogInnen oft mit deutsch-türkischen SchülerInnen aufgrund ihrer kulturellen und sprachlichen „Heimatlosigkeit" hatten, ist heute unzeitgemäß. Aziza-A spricht fließend Berlinerisch und Türkisch mit deutschem Akzent. Und eben dies Türkisch mit dem deutschem Akzent ist in der Türkei selbst schick und ein Zeichen für Emanzipation, Internationalität und Aufmüpfigkeit.
Multikulturelle Individuen lassen sich offensichtlich im Jahr der mißglückten doppelten Staatsbürgerschaft erfolgreich medial inszenieren. Die deutsch-türkische Gruppe „Sürpriz" vertrat Deutschland 1999 auf der Ausscheidung der Eurovision in Jerusalem mit dem als „multikulturell" etikettierten Song „Reise nach Jerusalem". Der Auftritt wird von Saz und SY 77 flankiert, die Gruppe singt deutsch, türkisch, englisch und hebräisch. Nur ein Gruppenmitglied ist nicht in Deutschland geboren. Die Sängerin Deniz Filizmen bekennt sich „jetzt als ein Teil von Deutschland" und fragt sich aber dann doch an einem Holocaust-Denkmal, was sie mit der deutschen Vergangenheit eigentlich zu tun hat.
(3) Es gibt bekanntlich viele Länder, in denen multikulturelle Identitäten selbstverständlich sind. Das Musterbeispiel sind die klassischen Einwanderungsländer wie USA oder Argentinien. Hier ist es selbstverständlich, daß ein Individuum sich gleichzeitig als „Deutscher" und „Amerikaner" bezeichnet, fühlt und verhält. In der einschlägigen pädagogischen Diskussion - insbesondere den 1994 erarbeiteten „National Standards for Music Education" - spricht man heute in den USA von „cultural diversity" und hat als Bezugspunkt den „ethnic mix", der dem „United State Census" folgend mit folgenden fünf Kategorien charakterisiert wird: European Americans, African Americans, Hispanic Americans, Asian and Pacific Americans und Indigenous Americans (American Indians, Eskimos, Aleut). Musikpädagogisch wird eine „cross-cultural experience" dadurch angestrebt, daß diese fünf ethnischen Gruppen gleichberechtigt im Musikunterricht beachtet werden. In breit angelegten Fortbildungsveranstaltungen bringen die Opinion Leaders der „Music Educators National Conference" den überwiegend anglo-amerikanischen MusiklehrerInnen die Musik der Schwarzen, Latinos, Asiaten und Indianer nahe. Bis auf die asiatische und indianische Musik genügt dabei die Berücksichtigung aktueller Popmusik.An US-amerikanischen Hochschulen wird in den Kursen MUS 107 und 407 „music of world cultures" obligatorisch gelehrt, und es gibt hierfür sehr gute Lehrbücher, die von Musikethnologen verfaßt, soziologisch aber auf aktuelle weltmusikalische Fragestellungen abgerichtet sind. Multikulturalität im deutschen Musikleben Neben der international orientierten Popularmusik- und Avantgarde-Szene kennt das deutsche Musikleben „Musik fremder Kulturen" in drei Erscheinungsformen:
- als „traditionelle Musik" (Folklore aus aller Welt vermittelt durch eingeflogene authentische Musikgruppen),
- als „authentische Popular Music" (in den Ursprungsländern entstandene „neue" Popmusik, deren Exponenten auf Welt-Tour gehen),
- als „Weltmusik" (bewußt inszenierte Fusionen mehrerer authentischer Musikkulturen, sei es in „traditionellem" oder „popular" Gewand).
Die in Deutschland lebenden Ausländer präsentieren sich mit allen drei der genannten Formen. Sind wir, indem wir die entsprechende Präsentation zulassen, bereits multikulturell? Sind die Fernsehzuschauer multikulturell, wenn sie auf der „Reise nach Jerusalem" von Sürpriz mitklatschen?
Der allgemeinbildende Musikunterricht scheint noch am ehesten multikulturell orientiert zu sein. Bei genauerem Hinsehen beschränken sich jedoch alle Musiklehrbücher auf internationales Liedgut sowie zwei bis vier Seiten mit musikethnologischen Themen. Lediglich im schülerorientierten Popmusik-Unterricht, d.h. vor allem in den „Grünen Heften", taucht regelmäßig das Genre „authentische Popular Music" auf, bei Volker Schütz sogar programmatisch als Hinführung zum Traditionellen.
Im Bereich der Massenmedien herrscht nach wie vor strikte Trennung in monokulturelle Radio-Wellen, Fernsehsender, Zeitschriften und Magazine. Es ist verblüffend, welch marginale Rolle der verbreitete und hochinteressante Türk-Rap in den zahllosen Service- und Fun-Music-Wellen spielt, die sich jugendorientiert geben. Zwischen den eigens dafür eingerichteten Multikulti-Wellen des SFB und WDR, den gesetzlich vorgeschriebenen „Gastarbeiter-Sendungen" auf Mittelwelle sowie den türkischen Fernsehsendern auf der einen und den deutschen Mainstream-Wellen und -Sender auf der anderen Seite gibt es so gut wie keine Durchlässigkeit. „Sürpriz" war innerhalb diese Hermetik in der Tat ein Surprise.
Der Deutsche Musikrat, in dem das musikalisch a ktive Volk mit allen seinen Gruppen, Verbänden und Managern vertreten ist, kennt keinerlei Mitgliedschaften aus den Kreisen der zahllosen ausländischen Folkloregruppen, die in Deutschland aktiv sind. Es gibt nach Auskunft von Fachreferenten keinerlei Anstrengungen, an diesem Zustand etwas zu verändern. Auch das Musikinformationszentrum kann keine Auskunft über „diese Szene" geben.Vor diesem Hintergrund haben wir eine Befragung aller niedersächsischen Musikschulen durchgeführt. 83% der 60 Musikschulen haben auf unsere Fragen geantwortet. An 27% dieser Musikschulen wird „Musik fremder Kulturen" unterrichtet, wobei „Samba" und „Percussion" dominieren. Die türkischen MitbürgerInnen werden nur von einer einzigen Musikschule des Landes mit einer Saz-Gruppe explizit bedient. 25% der Musikschulen sagen, daß sie multikulturellen Konzepten gegenüber aufgeschlossen wären, aber keinen Ansatzpunkt sähen. Die Nachfrageorientierung ermögliche auch kaum Experimente, wenn die türkischen Kinder nicht von sich aus kämen, dann habe man kaum Möglichkeiten aktiv zu werden. „Ausländische" Musiklehrer gibt es nur an „klassischen Instrumenten".
Alles in allem, es gibt in Deutschland im offiziellen Musikleben noch keinerlei Basis, auf der sich das Leitziel einer multikulturellen musikalischen Identität realistisch entwickeln ließe. Die Hochschulen bilden da keine Ausnahme. Gerade hier wird am Ideal der monokulturellen Identität programmatisch festgehalten. So sehen die mir bekannten Lehramts-Studienordnungen zwar vor, daß die künftigen MusiklehrerInnen in der Lage sein müßten, die verschiedenen kulturellen Verhaltensweise der SchülerInnen zu verstehen, aufzugreifen und zu integrieren. Sie können dies aber, so die herrschende Meinung, umso besser, je kulturell gefestigter sie selbst sind. Selbst die jüngsten Studienreform-Vorschläge des VDS, Musikrates oder der Bundesfachgruppe, sprechen diese Selbstverständlichkeit an jeweils entscheidender Stelle an: „Erfahrungen mit dem Instrument: ... zum einen soll das Instrument individuelle künstlerische Erfahrungen vermitteln, zum anderen ... zur Demonstration von Partiturausschnitten, zur Improvisation verwendet [werden]. Künstlerische Erfahrungen in einem oder zwei Instrumenten sind unabdingbar".
Fazit: Die Musik unserer „ausländischen MitbürgerInnen" ist im herrschenden Musikbetrieb zwar vorhanden, aber vollkommen ghettoisiert. Die traditionellen Institutionen wie Musikschulen oder Hochschulen sind weit davon entfernt, einen Beitrag zum Leitbild einer multikulturellen musikalischen Identität zu leisten.